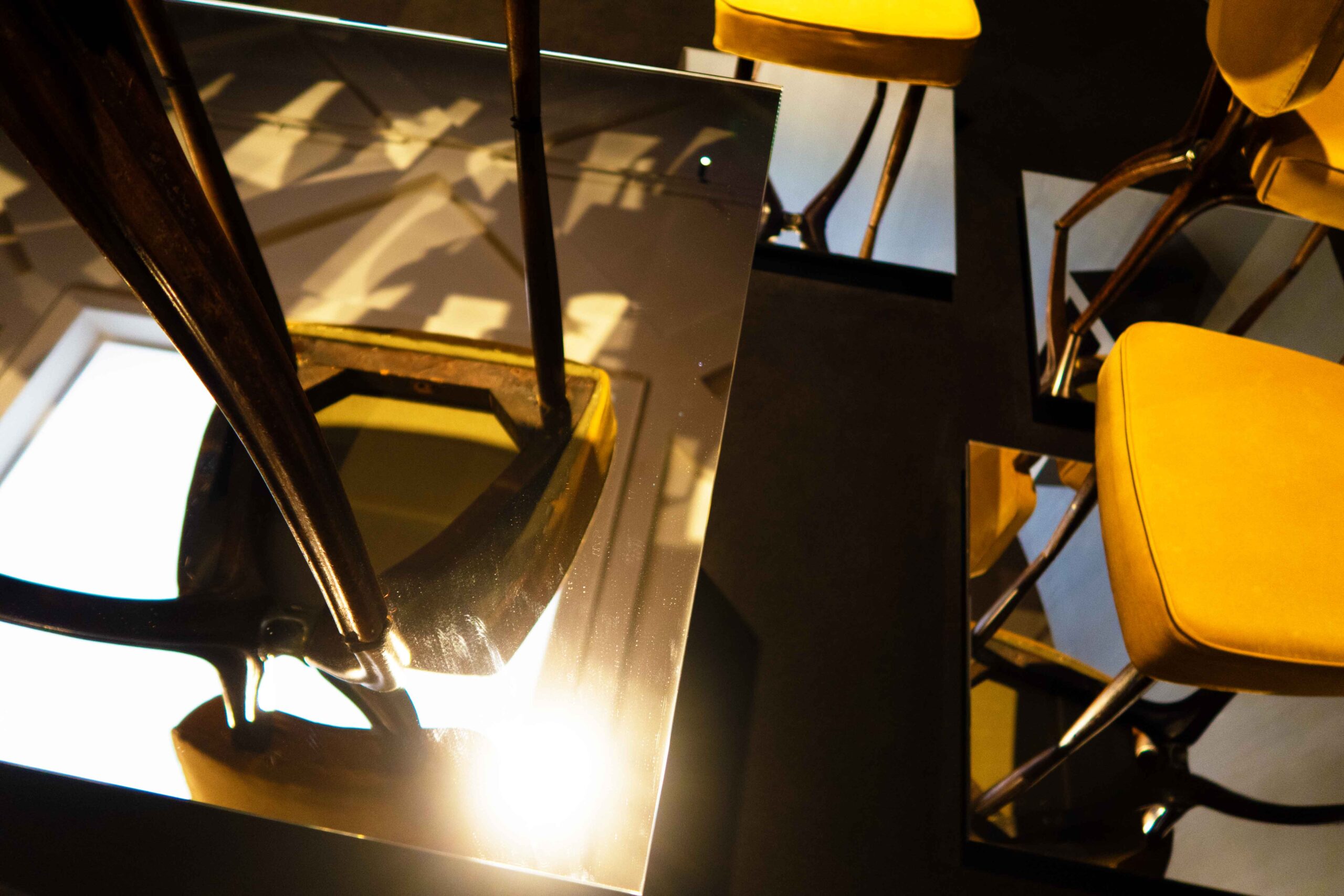Monat: Oktober 2021

… Biscotti, Grissini, Apfelkuchen, Vollkornbrötchen, Butter, ein Gläschen mit Marmelade – Pfirsichgeschmack – Joghurt, Doughnut, Schokoladenkeks, Schinken, Wurst, Käse, un Bacio di Dama, ein Schokoladenherz, ein Dolce piccolo, Nutella, ein Schaumbrötchen – alles sorgsam und millimetergenau auf einem Frühstückstablett drapiert, dazu Latte macchiato, Wasser. Der Barista ein Könner und Künstler. Dafür erbat er sich allerdings bei seinen Gästen Geduld, und leider erfreuten sich nicht alle des Wartens und seiner Künste.
Aber wer ist denn so unkultiviert, solche Werke zu verachten? Oder genauer: Wer glaubt denn, nur hohe Kunst sei der Bewunderung wert und nicht eine solche Assemblage? Eine visuelle Komposition? Nein, keine Collage, hier wird nicht mit Leim hantiert, sondern so fein geordnet, dass auch beim Servieren nichts herunterfällt oder durcheinandergerät.
Und beim genussvollen Verspeisen des Kunstwerkes – bei seiner Zerstörung, nota bene – macht sich der geneigte Gast Gedanken zu den Beweggründen des Schöpfers.
Und er stellt sich vor, dieser Barista sei keineswegs von jeher ein grosser Frühstückskünstler gewesen, im Gegenteil, sondern ein ausgesprochen nachlässiger, unbedachter und sorgloser Mensch, jung, unerfahren, einer, der sich einbildete, die Welt mit ein paar munteren Sprüchen und etwas Charme zu erobern, oder vielleicht gar mit einer überheblichen Miene; doch das waren Illusionen, unter denen er mehr als einmal auf die Nase fiel. Ja er schlug sie sogar blutig und musste üble Konsequenzen tragen, wurde da und dort davongejagt, fand kein Auskommen, wusste mit seinen Talenten nichts anzufangen, zumal er sie gar nicht kannte.
Dabei lagen seine Talente nicht nur auf der Hand, sondern in der Hand, besser, in seinen geschickten Händen, und er musste lernen, dass das Leben nichts zum Verwöhnen bereithält. Oder doch? Er lernte Besseres: Dass das Leben zum Verwöhnen da ist – zum Verwöhnen anderer.
Unser Federico – wir nennen ihn einmal so – hatte seine Berufung noch lange nicht gefunden, sondern versuchte sich allerorts: als Ticketverkäufer, Mechanikergehilfe, Museumswärter, Taxifahrer – alles ohne Glück.
Schliesslich fand er – eher zufällig – Arbeit in einem Caffè. Da begann er keineswegs mit Freude, nein, auch diese Tätigkeit war ungeliebt und nicht wirklich gesucht. Entsprechend nachlässig bediente er die Gäste, die er nicht für die seinen hielt. Der Besitzer hatte ihn nur mangelhaft instruiert, liess ihn dafür bald allein die Arbeit verrichten, denn er führte zudem eine Locanda, die viel einträglicher war. Federico arbeitete soso lala; viele Gäste kamen ohnehin nicht, einzelne nur einmal und dann nie wieder, und es war eine Frage der Zeit, bis auch dieses Tun ein Ende nehmen würde.
Und wie wieder einmal die Glastür geht und scheppert, und eine Stimme Cappuccino con Cornetto bestellt, hebt unser Federico nicht einmal seinen Blick, sondern macht sich an der Faema-Maschine zu schaffen, lässt das heisse Wasser durch den Kaffeeflüchtig gepressten rinnen, packt mit der Zange ein Cornetto und platziert es auf ein Tellerchen, trägt sein Tablett zum Tischchen, das der Gast sich gewählt hat. Der Gast? Was für ein Gast?
Im selben Moment, in dem Federico die Tasse mit dem Cappuccino auf dem Tischchen platziert, unsorgfältig, so dass gar eine Spur des Milchschaums über den Rand schwappt, blickt er ins Gesicht – der wunderschönsten Frau, die ihm je begegnet ist, ins Gesicht, in ihre Augen, die eben aufblicken, zu ihm aufblicken, erstaunt, in seine Augen schauen, dann das Tässchen mit dem Milchstreifen sehen, ja sehen, Federico muss den zweiten Blick, der ihn trifft, über sich ergehen lassen, muss ihn aushalten, und wir tun uns schwer mit den Worten, denn es ist ein ganz kurzer Moment, ein Augenblick, un attimo, wie die Italiener sagen, in dem nur eine einzelne Bewegung Platz hat, das Innehalten, das Zögern, das Erstarren Federicos, und dann der unendlich lange attimo, kein attimo, sondern eine Ewigkeit, in der er vor Scham errötet, in den Boden sinken möchte, über sein Missgeschick, das eben kein Missgeschick ist, ein Missgeschick ist eine Nebensächlichkeit, verzeihlich, jedes Missgeschick ist verzeihlich, nicht aber eine Nachlässigkeit, nicht eine Schlampigkeit, und Federico schämt sich, schämt sich eine Ewigkeit lang über den Streifen Milch, der auf der Aussenseite der Tasse mit unendlicher Langsamkeit niedergleitet.
Schliesslich aber fasst er sich, unser Federico, und das war sein Glück. Die Sache zu retten. Nicht aufzugeben. Dem Blick standzuhalten. Federico trug das Ganze zurück zur macchina, platzierte eine neue Tasse unter deren Hahn, bereitete eine neue Portion Kaffee vor, spannte sie in den Schlitz der Maschine, schäumte nochmals Milch – setzte mit grösster Sorgfalt die Tasse auf ein neues Tellerchen und trug sie mit noch grösserer Achtsamkeit zum Tischchen und unter die Augen der Schönen. Sie neigte ein klein wenig den Kopf, dankte und erbat sich ein Glas Wasser. Auch dies besorgte Federico, rückte dann, um seine plötzlich erwachte Dienstfertigkeit zu betonen, den Teller mit dem Cornetto sachte zurecht und neben den Kaffee und das Wässerchen.
Bald einmal erhob sich die junge Dame, bezahlte an der Bar, liess ein kleines Trinkgeld in die Kasse gleiten und verschwand zur Tür hinaus. Federico eilte, um das Geschirr zurückzutragen, und mit Bedacht und Sorgfalt stellte er es in die Waschmaschine.
Natürlich träumte Federico in den nächsten Nächten von der Schönen. Träumen ist ungenau beschrieben, er träumte und wachte, und die Traum- und Wachbilder flossen ineinander. Ein sanftes, zartes, helles Gesicht, mit aufmerksamem, besonnenem Blick der tiefen Augen, kräftiges, dunkelbraunes, tiefbraunes, doch nicht schwarzes Haar, ein ebenso kräftiger, doch eher kleingewachsener Körper, was er rasch zur Kenntnis nahm, war er, Federico, doch ebenso kleingewachsen und trug in sich eine entsprechende Scheu vor grossen Frauen.
Es war eine Prinzessin, es musste eine Prinzessin sein, und Federico fürchtete, dass sie sich nie mehr zeigen würde, nie mehr, dass sie sich lediglich ins Caffè verirrt hatte, dass sie ganz woanders hingehörte, in andere Gaststätten, in gepflegte Hotels, ja auf einen weitläufigen Landsitz … Aber dann trat sie plötzlich doch wieder ins herein. Federico war gerade mit den Wünschen dreier Herren beschäftigt – die er allerdings – nach seiner schamvollen Erfahrung – genauso bediente, wie er die Prinzessin bedient hatte: aufmerksam, präzise, mit der richtigen Menge Schaum und Schokoladepulver, mit einem Wassergläschen und wohlgesetztem Cornetto auf dem Tellerchen.
Er hatte sich geschworen, keine Blösse mehr zu geben, keine Unachtsamkeit, keine Nachlässigkeit; immer noch sass die Scham im Nacken. Nein, vielmehr hatte er insgeheim gehofft, dadurch die Prinzessin wieder heranlocken zu können, sozusagen ihr – auf irgendeine magische Weise – zu verstehen geben, dass er sich gewandelt habe. Und nun sass sie wieder da. Gleich neben der Tür. Und wartete. Und musste noch eine ganze Weile warten, denn zwei Damen, die noch vor ihr erschienen waren, wünschten Wein und waren bei der Wahl kompliziert und langfädig, und Federico brannten die Nägel. Aber auch da bemühte er sich, bis er endlich die Prinzessin bedienen konnte. Offensichtlich hatte sie mit wachen Augen seine Eile und Sorgfalt beobachtet, denn sie begrüsste ihn mit einem Lächeln, bei dem sie die Lippen kräuselte, so reizend, dass Federico wieder errötete, diesmal nicht vor Scham, sondern aus Freude und Verliebtheit.
Die beiden fanden sich, wer will denn das Gegenteil vermuten. Die Prinzessin ist keine Prinzessin, natürlich nicht, und doch ist sie eine Prinzessin, jedenfalls nennt Federico sie heute noch so. Sie war Hausmädchen in einem Hotel. Mit Ambitionen. Und so ist sie heute nicht nur Mutter von zwei Töchtern, sondern auch für die Hauswirtschaft eines Hotels zuständig. Sie hat sich weitergebildet. Und ihr Mann – Federico – leitet immer noch seine Bar. Er hat sie sich längst zu Eigen gemacht. Aber er öffnet sie erst am späteren Morgen, denn in der Frühe besorgt er la colazione der Hotelgäste. Da, wo er seine Prinzessin verehrt. Und auf den Frühstückstabletts seine Kunstwerke gestaltet …

… nel museo: «ASK ME» steht auf der Brust der jungen freundlichen Führerin durch die Design-Ausstellung. Design aus den Fünfziger-, Sechzigerjahren. Aus meiner Jugendzeit. Olivetti. Rechenmaschinen, Schreibmaschinen – die ersten Computer. Hier im Rahmen des damaligen Designs von Sofas, Nähmaschinen, Kleiderständer, Büchergestellen, Sesseln in allen Formen: vom Säulenkapitell bis zur überdimensionierten Kusslippe, von der zerquetschten Birne, die heute noch in Wohnungen steht, bis zum exquisiten Lederschaukelstuhl. Sie gleitet mit uns an Glastischen und elegant geschreinerten Kommoden vorbei, führt uns durch all die Schaustücke, die Erinnerungen an die Zeit wecken, in der ich so alt war, wie die Führerin heute.
Aber nicht die Erinnerungen stehen im Mittelpunkt des Interesses, sondern die junge Frau. Etwas blass, mit gewelltem hellbraunem Haar, schlank, mit Maske – die wir hier ja alle tragen, so dass nur die aufmerksamen, ja prüfenden blauen Augen unter den zarten Brauen genauer zu sehen sind.
Ihre freundliche Mühe, mit denen sie uns zusammengewürfelten Geführten die Gegenstände näherbringt, hat etwas Vertrauensvolles, Vertrauenerweckendes, und für eine Weile versinken wir alle in jene Zeit – wohl auch ausgelöst durch ihre Stimme, die mit Achtung, ja mit einem gewissen Stolz die Geschichte jenes Mann ins Zentrum setzt, der hier, in der Lombardei den Aufschwung massgeblich befördert hat: Adriano Olivetti. Schreibmaschinen sind zum Schreiben da – aber auch zur Ankündigung einer neuen Zeit. Einer Nachkriegszeit, einer Zeit, in der man nicht nur im Büro schreibt, sondern unterwegs, unterwegs in eine Zukunft, und so war Olivettis neue Schreibmaschine leuchtend rot, feuerrot, lippenstiftrot, farbig, um neue, farbenfrohe, erotische Gedichte zu schreiben, gefühlvolle, glühende, und nicht nur das, sondern auch Pamphlete, Aufrufe zum Sturz der damals geltenden, lähmenden Ordnung.
Hier im lombardischen Museum ist das Design vereint. Doch die zugeordneten Fotos zeigen die Differenzen. Die wohlgeformten Möbel aus edlem Tropenholz für die bürgerlichen Behausungen, die Kunststoffleuchte und das Transistorradio, die bald auch einmal im Warenhaus zu kaufen sind, für die Studentenbude. Jedenfalls Verheissungen. Die die Welt erstrebenswert machten.
Aus den Erinnerungen an jene Zeit folgen die Wünsche an die junge Designführerin, mit der ich gern noch etwas geplaudert hätte, doch war sie bald einmal mit ihrem Handy beschäftigt, und das bedeutet heutzutage: Stör mich nicht! Ja, gewiss, ein gewisser Widerspruch zur Aufschrift auf ihrem Pullover.
Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit meinen Gedanken zu ihr auseinanderzusetzen. Denn ohne Zweifel ist sie selbst Studentin, und ohne Zweifel selbst an der Schule für Design. Und bald schon Mitdesignerin bei einer neuen Verheissung, bei einem neuen Anrollen des Gedankens, der Ideen, der Gestaltung, in einer neuen Welt, mit neuen Formen, neuen Farben, neuen Konstrukten und neuen Plätzen, Häusern, Wohnungen, Tischen, Tellern, Gebäcken. Und allem kommt neue Bedeutungen zu, neue Funktionen, oder vielmehr: keine Funktionen mehr, alles wird sich zu einem Spiel entwickeln, und die Formen würden nicht mehr den Funktionen folgen, sondern die Funktionen würden sich im Spiel der Formen finden.
FFF war ohnehin nur eine Werbemasche: form follows function. Die Form hat sich nie der Funktion unterworfen, sondern ist ihr immer vorausgeeilt, oder hat sie wenigstens eingepackt. Verhüllt wäre das bessere Wort.
In der neuen Welt würde das Museum würde seine angestammte Funktion verlieren, oder wenigstens verändern, denn es wäre nicht mehr Präsentiertablett vergangener Entwürfe und Geräte, sondern Spielort zukünftiger Formen.
Das wird seine Zeit dauern, und unser Olivetti-Fräulein wäre nicht mehr so ganz jung, sondern reife Frau und stolz ihre eigenen Entwürfe, und der verblichene Adriano wäre nur noch im Hintergrund, lächelnd, seinerseits stolz auf seine Nachfolgerin …